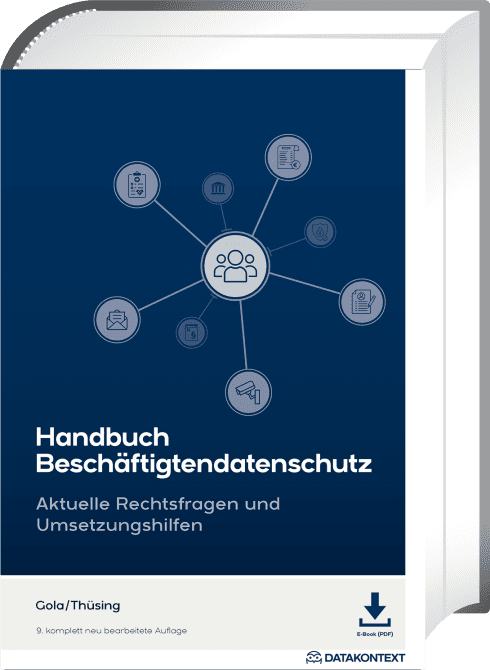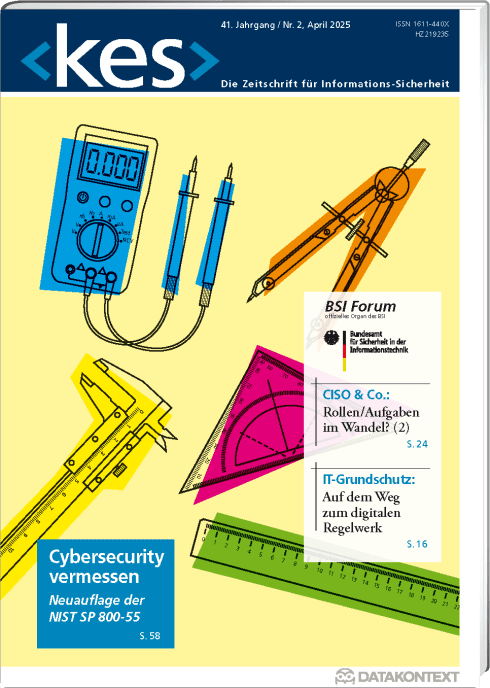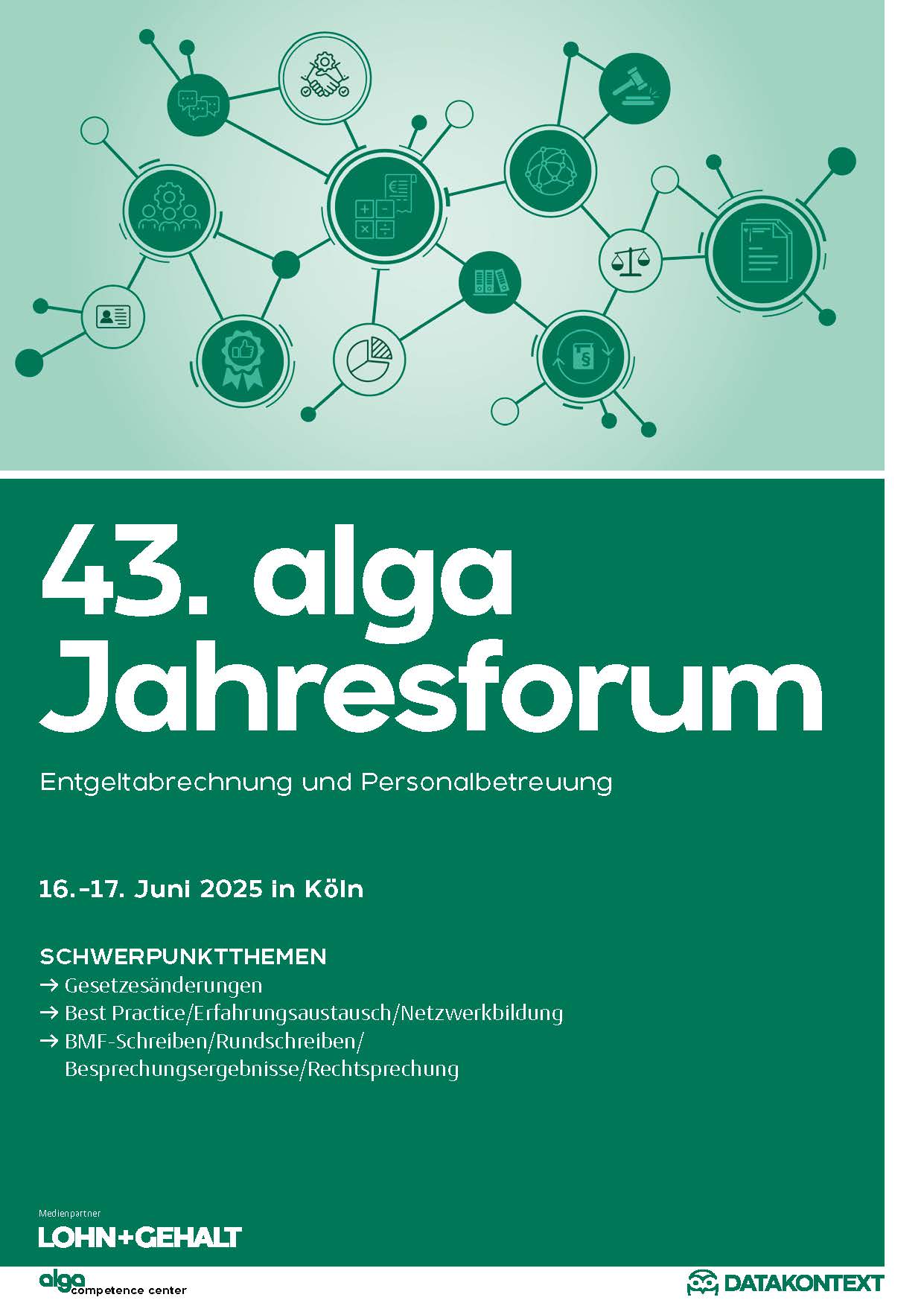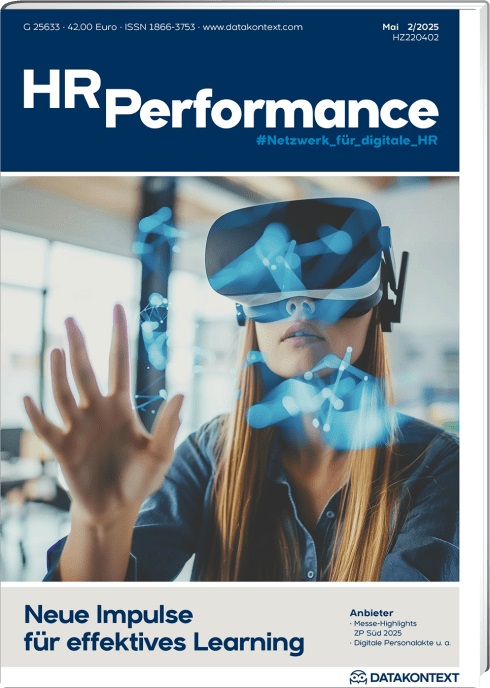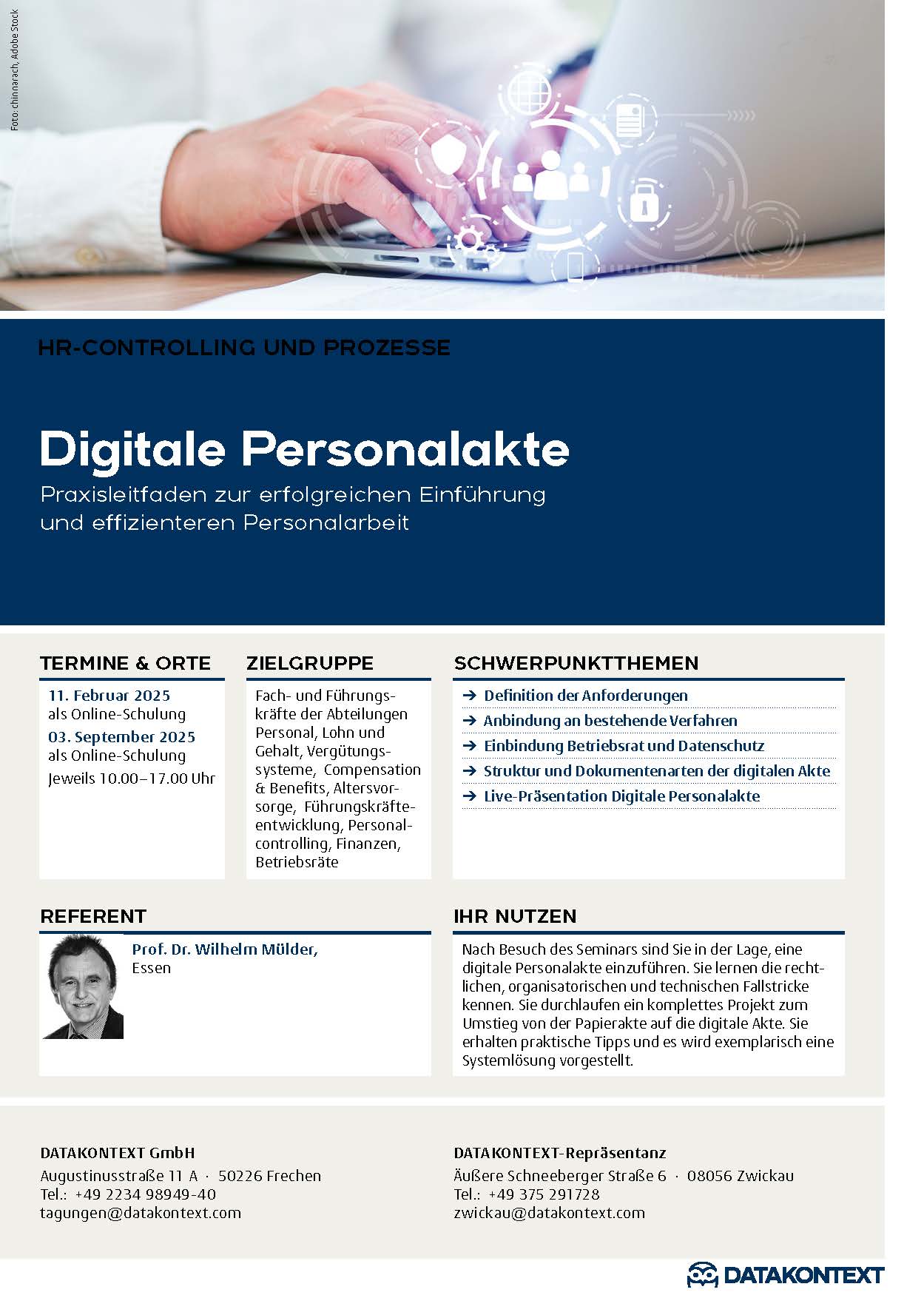Arbeitsgemeinschaft (ARGE) betrieblicher Datenschutz
Bleiben Sie im betrieblichen Datenschutz auf dem Laufenden! Nehmen Sie an der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) betrieblicher Datenschutz teil

- Artikel-Nr.: SW10094.1
- Start erster Tag: 10:00 Uhr
- Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 5 Tage
Die Praxisprobleme für betriebliche Datenschutzbeauftragte nehmen ständig zu. Die technischen, rechtlichen und organisatorischen Herausforderungen wachsen deutlich. Das Zeitbudget in der Regel nicht. Die Lösung ist ein professioneller Informationsinput.
Die Teilnehmer erhalten vor der ARGE die Möglichkeit, gezielt Fragestellungen anzumelden, die von der ARGE-Leitung vorbereitet werden. In der ARGE werden diese Fragestellungen und andere von den Teilnehmern eingebrachten Probleme aus ihrer Praxis diskutiert. Ziel ist es, praktische Lösungsansätze zu entwickeln und einen aktiven Erfahrungsaustausch zwischen Teilnehmern und ARGE-Leitung zu ermöglichen.
Nutzen auch Sie die ARGE betrieblicher Datenschutz für einen regelmäßigen und praxisorientierten Informations- und Erfahrungsaustausch.
Technische Hinweise für unsere Teilnehmer/innen von Online-Schulungen:
Eine Audioausgabe an Ihrem Gerät ist erforderlich. Ebenso wie ein Micro, wenn Sie sprechen möchten bzw. eine Kamera, wenn Sie gesehen werden möchten.
Rechtzeitig vor Seminarbeginn erhalten Sie Ihren persönlichen Link zum virtuellen Seminarraum. Folgen Sie den Hinweisen und betreten Sie die Onlineschulung. Es ist keine Software-Installation erforderlich!
Der Veranstalter behält sich vor, das Präsenz-Seminar bis 14 Tage und die Online-Schulung bis 2 Tage vor Beginn zu stornieren.
- Aktuelles von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Aufsichtsbehörden
- KI-Verordnung vs. DS-GVO: Regulierung von KI vs. Datenverarbeitung für KI
- Datenverarbeitung im Konzern
- DS-GVO trifft Datenverordnung: Wie Datenwelten zusammenwachsen
- EDSA: Übersicht über Leitlinien und wesentliche Inhalte
TAGESORDNUNG 1. TAG 10 –17 UHR
Begrüßung
- Fragen und Wünsche der Teilnehmer und Teilnehmerinnen
- Organisatorisches
Aktuelle Entwicklungen
- Aktuelles vom Gesetzgeber, aus Deutschland und Europa
- Neue Rechtsprechung zum Datenschutz
- Über die Tätigkeiten der Aufsichtsbehörden
KI-Verordnung vs. DS-GVO: Regulierung von KI vs. Datenverarbeitung für KI
Künstliche Intelligenz (KI) wirkt ähnlich disruptiv wie vor dreißig Jahren das Internet. Die EU hat mit der „KI-Verordnung“ das Herstellen, Anbieten und Nutzen von KI zu regulieren, belässt es im Datenschutz aber im Wesentlichen bei der DS-GVO. In Deutschland soll es zudem im kommenden Beschäftigtendatenschutz ausdrücklich eine Regelung zur Nutzung von KI im Arbeitsverhältnis geben. Damit ist es Aufgabe der Datenschutzbeauftragten und Datenschutzabteilungen, selbst eine Einordnung von KI im Datenschutzrecht vorzunehmen.
- KI, Machine Learning, Deep Learning: Eine kurze Einordnung
- KI-Verordnung: Regulierung von KI und Pflichten für Hersteller, Anbieter und Nutzer
- Datenschutz: Wie reguliert die DS-GVO die Datenverarbeitung mittels KI
- Querschläger: Was bedeutet das Scoring-Urteil des EuGH für KI-Systeme?
- Praktische Anwendungsfälle von KI und deren datenschutzrechtliche Bewertung
Teilnehmerfragen Teil 1
Fragen aus der Praxis der Teilnehmer werden erörtert, die entweder nicht in die Themenblöcke passen oder diese Themen vertiefen.
Datenverarbeitung im Konzern
Innerhalb von Unternehmensgruppen bzw. zwischen verbundenen Unternehmen gibt es eine fast unendliche Vielzahl von Gründen, warum personenbezogene Daten nicht beim einzelnen Rechtsträger verbleiben. Viele dieser Gründe sind berechtigt, etliche weitere zumindest nachvollziehbar – doch reicht dies?
- Mehrere (gemeinsam) oder ein (allein) Verantwortlicher: Grundregel – und Ausnahmen?
- Shared Service Center und das „Konzernprivileg“ in der DS-GVO
- National oder international, welche Unterschiede macht die DS-GVO diesbezüglich?
- Veränderungen des Konzerns: Due Dilligence und Post Merger Integration
- Arbeiten in Matrixstrukturen: Wie datenschutzrechtlich absichern?
TAGESORDNUNG 2. TAG 9 –16 UHR
DS-GVO trifft Datenverordnung: Wie Datenwelten zusammenwachsen
Die digitale Strategie der EU aus dem Jahr 2020 zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas konzentrierte sich auf Technologien, die den Menschen zugutekommen, eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und eine offene und demokratische Gesellschaft. 2021 wurde diese Strategie durch den digitalen Kompass für 2030 ergänzt, in dem festgehalten wurde, welche Ziele die EU in diesem Jahrzehnt für den digitalen Bereich hat. Das Stichwort „Datenrecht“ beherrscht seitdem viele Übersichten und Publikationen, doch welche Auswirkungen haben die neuen Vorschriften auf das vorhandene Datenschutzrecht?
- Konzepte und Inhalte der Datenverordnung in der Übersicht
- Neue Begrifflichkeiten und Beteiligte im Datenrecht
- Abgrenzung zwischen Datenverordnung einerseits und DS-GVO andererseits
- Verhältnis des Rechts auf Datenzugang zum Datenschutzrecht
- Praktische Umsetzung der Datenverordnung
Teilnehmerfragen Teil 2
Wurden im ersten Teil nicht alle Fragen der Teilnehmer beantwortet, wird die Diskussion hier fortgeführt.
EDSA: Übersicht über Leitlinien und wesentliche Inhalte
Dem Europäischen Datenschutzausschuss (EDSA) kommt die Aufgabe der Sicherstellung der einheitlichen Anwendung der DS-GVO und der Richtlinie (EU) 2016/680 in allen EU-Mitgliedstaaten sowie in Norwegen, Liechtenstein und Island zu. In Form von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren soll der EDSA nach eigener Ansicht eine allgemeine Orientierung geben, indem er zur Präzisierung der Bestimmungen der DS-GVO beiträgt. Dabei sind seine Kompetenzen nicht mit denen von Gerichten vergleichbar und der EDSA sollte auch nicht mit dem Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) verwechselt werden.
- Rechtsnatur, Besetzung und Aufgaben des EDSA
- Anwendungsbereich sowie Sinn und Zweck des Kohärenzverfahrens
- Rechtliche Wirkung von „Leitlinien“
- Übersicht über bisherige Leitlinien und deren wesentliche Inhalte
- Informationen über aktuelle Entwicklungen zu Datenschutz und Informationssicherheit
- Berichte aus der Datenschutzpraxis und Best Practice
- Informationen aus der Prüfpraxis der Aufsichtsbehörden
- Auswertung der Rechtsprechung
- Recherche von Fachliteratur und Fachzeitschriften
- Beantwortung von aktuellen Tagesfragen
- Entwicklung eines Teilnehmer-Netzwerkes
Michael Brauwers, Markus Stier
Andreas Sachs, Kristin Benedikt, Dr. Axel Freiherr von dem Bussche, Jan Morgenstern, Marc Neumann, Michelle Petruzzelli, Christian Bennefeld, Dr. Patrick Grosmann, Ben R. Hansen, Prof. Ulrich Kelber, Dr. Hans Markus Wulf, Alexandra Palandrani, Sebastian Schreiber, Dr. Felix Sühlmann-Faul , Marco Müllner
Sabine Törppe-Scholand, Markus Stier
Dr. Andreas Hofelich, Torsten Franke
Sabine Törppe-Scholand, Janette Rosenberg
Prof. Dr. Rolf Schwartmann, Fritz-Ulli Pieper